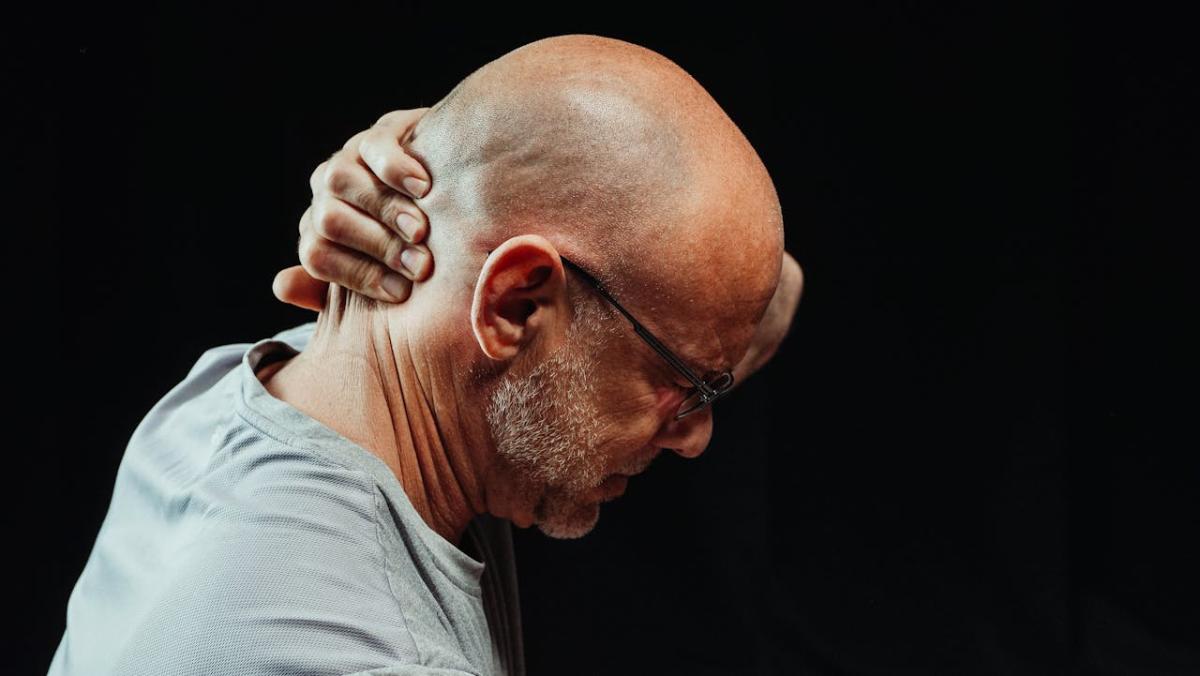Ein plötzlicher, stechender Schmerz im Bein. Taubheitsgefühl. Ein Gliedmaß, das sich kälter anfühlt als der Rest des Körpers.
Diese Symptome können viele Ursachen haben, darunter auch eine periphere arterielle Embolie. Obwohl diese Erkrankung weniger bekannt ist als Herzinfarkte oder Schlaganfälle, kann sie den Blutfluss und die Funktion der Gliedmaßen beeinträchtigen. Aufgrund ihres plötzlichen Auftretens und möglicher Komplikationen steht sie im Mittelpunkt der Gefäßgesundheit.
Dieser Artikel bietet einen informativen Überblick über periphere arterielle Embolien. Er beschreibt mögliche Ursachen, Symptome, diagnostische Überlegungen und allgemeine Behandlungsansätze.
Was ist eine periphere arterielle Embolie?
Eine periphere arterielle Embolie (PAE) bezeichnet die plötzliche Verstopfung einer peripheren Arterie durch eine Substanz, die aus einem anderen Teil des Körpers über den Blutkreislauf dorthin gelangt ist.
Periphere Arterien sind Blutgefäße, die sauerstoffreiches Blut vom Herzen zu den Gliedmaßen und anderen Bereichen außerhalb des Herzens und des Gehirns transportieren. Eine Blockade in einer dieser Arterien kann den Blutfluss unterbrechen, am häufigsten in den Beinen. Wenn das Blut das Gewebe nicht erreichen kann, sinkt der Sauerstoffgehalt.
Wenn der Blutfluss nicht wiederhergestellt wird, kann es zu Gewebeschäden kommen.
Zwei häufige Arten der Arterienverstopfung sind Embolie und Thrombose.
- Eine Embolie tritt auf, wenn sich in einem Teil des Körpers ein Gerinnsel, eine Luftblase oder ein Fetttröpfchen bildet und durch den Blutkreislauf wandert, bis es sich in einer kleineren Arterie festsetzt.
- Eine Thrombose bezeichnet ein Gerinnsel, das sich direkt an der Stelle der Blockade bildet, häufig aufgrund einer Verletzung der Blutgefäße oder einer Ablagerung von Plaque.
Bei einer peripheren arteriellen Embolie entsteht der Embolus häufig im Herzen. Dies ist eher bei Personen mit Erkrankungen wie Vorhofflimmern oder Herzklappenerkrankungen der Fall.
Sobald er sich gelöst hat, wandert der Embolus durch den Blutkreislauf und kann sich in einer verengten Arterie in den Gliedmaßen festsetzen. Dies kann zu einer Ischämie führen, bei der das Gewebe zu wenig Sauerstoff erhält. Ohne ausreichend Sauerstoff kann es zu Gewebeschäden kommen.
Epidemiologie und Risikofaktoren
Periphere arterielle Embolien sind nicht so häufig wie andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, stellen jedoch für bestimmte Personengruppen nach wie vor ein Problem dar. Sie treten tendenziell häufiger bei älteren Erwachsenen und bei Personen mit Erkrankungen auf, die das Risiko für Blutgerinnsel erhöhen.
In vielen Fällen bildet sich ein Gerinnsel im Herzen und gelangt dann über den Blutkreislauf in eine periphere Arterie, wo es sich festsetzt. Dies kann ohne oder mit nur geringen Vorwarnzeichen geschehen.
Das Verständnis der Risikofaktoren kann Patienten und Ärzten helfen, Personen zu erkennen, die ein erhöhtes Risiko für diese Erkrankung haben.
Häufige Risikofaktoren
- Vorhofflimmern: Unregelmäßige Herzrhythmen können zur Bildung von Blutgerinnseln im Herzen führen, die in die peripheren Arterien gelangen können.
- Atherosklerose: Die Ablagerung von Plaque in den Arterien kann die Blutgefäße verengen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Embolus festsitzt. Sie trägt auch zum allgemeinen kardiovaskulären Risiko bei.
- Koronare Herzkrankheit: Erkrankungen der Herzblutgefäße können ebenfalls den Blutfluss zu den peripheren Arterien beeinträchtigen.
- Herzklappenerkrankungen: Beschädigte Herzklappen können zur Bildung von Blutgerinnseln führen, die sich lösen und durch den Blutkreislauf wandern können, wo sie andere Arterien verstopfen.
- Kürzlich durchgeführte Operationen: Insbesondere Operationen am Herzen, an den Blutgefäßen oder an den unteren Extremitäten erhöhen das Risiko der Bildung von Blutgerinnseln.
Seltene Risikofaktoren
- Hyperkoagulable Zustände erhöhen das Risiko einer abnormalen Gerinnung, wie z. B. die Faktor-V-Leiden-Mutation oder das Antiphospholipid-Syndrom.
- Eine Fettembolie entsteht, wenn Fettkügelchen aus Knochenbrüchen in den Blutkreislauf gelangen und periphere Arterien verstopfen.
- Eine Amnionflüssigkeitsembolie ist eine Komplikation, die während der Geburt auftreten kann, wenn Amnionflüssigkeit in den Blutkreislauf gelangt und eine Embolie verursacht.
Ursachen einer peripheren arteriellen Embolie
Das Erkennen der Ursachen einer peripheren arteriellen Embolie ist für die Früherkennung und Behandlung von entscheidender Bedeutung.
Die häufigste Quelle für Embolien ist das Herz, insbesondere bei Personen mit Vorhofflimmern oder Herzklappenerkrankungen.
Bei Vorhofflimmern kann ein unregelmäßiger Herzschlag zur Bildung von Blutgerinnseln im Herzen führen. Diese Gerinnsel können durch den Blutkreislauf wandern und Arterien in den Gliedmaßen verstopfen. Ebenso können Herzklappenerkrankungen zur Bildung von Gerinnseln im Herzen führen, die sich möglicherweise in die peripheren Arterien embolisieren (wandern).
Ein weiterer häufiger Auslöser ist ein Myokardinfarkt (Herzinfarkt). Nach einem Herzinfarkt kann sich im Herzen ein Blutgerinnsel bilden, das sich lösen und in die Arterien der Gliedmaßen wandern und diese verstopfen kann.
In einigen Fällen können auch seltenere Erkrankungen zur Entstehung einer PAE beitragen. Ein Beispiel hierfür ist die paradoxe Embolie. Diese tritt auf, wenn ein Gerinnsel durch eine kleine Öffnung im Herzen, beispielsweise ein offenes Foramen ovale, gelangt. Es umgeht die Lunge und gelangt in den systemischen Kreislauf, wo es sich in einer peripheren Arterie festsetzen kann.
Eine weitere seltene Ursache ist die infektiöse Endokarditis, eine Infektion der inneren Herzauskleidung. Bei dieser Erkrankung können sich kleine infizierte Gerinnsel, sogenannte septische Embolien, an den Herzklappen bilden und durch den Blutkreislauf wandern, was zu weiteren Komplikationen führen kann.
Symptome und klinisches Erscheinungsbild
Eine periphere arterielle Embolie kann je nach Lage und Schweregrad der Blockade verschiedene Symptome verursachen. In den meisten Fällen tritt sie plötzlich auf, in einigen Fällen kann sich die Erkrankung jedoch allmählich entwickeln.
Häufige Symptome
- Akute Schmerzen in den Gliedmaßen: Plötzliche, stechende Schmerzen, häufig in den Beinen.
- Blässe: Blässe der betroffenen Gliedmaßen aufgrund einer eingeschränkten Durchblutung.
- Kältegefühl: Die betroffenen Gliedmaßen fühlen sich aufgrund der verminderten Durchblutung kälter an als der Rest des Körpers.
- Pulslosigkeit: Der Puls in den betroffenen Gliedmaßen ist nicht oder nur schwer zu fühlen.
- Parästhesien: Kribbeln, Taubheitsgefühl oder ein „Nadeln” aufgrund einer Nervenfunktionsstörung durch schlechte Durchblutung.
Seltene Symptome
Bei Personen mit zugrunde liegenden Gefäßerkrankungen (wie Arteriosklerose) können die Symptome allmählich auftreten. Dazu können Schmerzen, die kommen und gehen (intermittierend), oder Beinermüdung gehören, die sich mit der Zeit verschlimmern können.
Gelegentlich kann die Embolie systemische Symptome wie Fieber, Unwohlsein oder Anzeichen einer Mehrfachorganbeteiligung verursachen. Dies tritt besonders häufig auf, wenn die Embolie mit einer Infektion wie einer infektiösen Endokarditis einhergeht, die infizierte Blutgerinnsel verursachen kann, die sich im gesamten Körper ausbreiten. Diese Symptome können auf die Notwendigkeit einer medizinischen Untersuchung hinweisen.
Diagnose einer peripheren arteriellen Embolie
Das Verständnis der Untersuchung einer peripheren arteriellen Embolie kann dazu beitragen, die Erwartungen der Patienten während des Diagnoseprozesses zu klären.
Klinische Untersuchung
Der Prozess beginnt in der Regel mit einer Überprüfung der Krankengeschichte und der aktuellen Symptome des Patienten. Vorerkrankungen wie Vorhofflimmern, Herzerkrankungen oder kürzlich durchgeführte Operationen können die Wahrscheinlichkeit eines embolischen Ereignisses erhöhen.
Die körperliche Untersuchung umfasst häufig die Überprüfung der betroffenen Extremität auf Anzeichen einer verminderten Durchblutung, wie z. B. Farbveränderungen, Kälte oder fehlende Pulse. Um ähnliche Symptome auszuschließen, muss Ihr Arzt andere Erkrankungen wie eine tiefe Venenthrombose (TVT) oder eine Infektion in Betracht ziehen.
Bildgebende Diagnostik und Tests
Bei Verdacht auf eine PAE können Ärzte zusätzliche Instrumente einsetzen, um die Durchblutung zu beurteilen und die Quelle der Blockade zu lokalisieren:
- Doppler-Ultraschall: Ein nicht-invasiver Test, bei dem mithilfe von Schallwellen Veränderungen im Blutfluss festgestellt und arterielle Blockaden identifiziert werden. Dieser Test wird häufig als erstes Screening-Instrument eingesetzt.
- CT- und MRT-Angiographie: Diese bildgebenden Verfahren liefern detaillierte Bilder der Blutgefäße und helfen, die Stelle und das Ausmaß einer Blockade zu identifizieren.
Bluttests
Bluttests können eine PAE zwar nicht allein bestätigen, aber sie können die Beurteilung unterstützen und helfen, andere Erkrankungen auszuschließen:
- D-Dimer: Erhöhte Werte können auf ein Blutgerinnsel hinweisen.
- Großes Blutbild (CBC): Kann helfen, Infektionen, Anämie oder abnormale Thrombozytenwerte zu erkennen.
- C-reaktives Protein (CRP): Ein Entzündungsmarker, der auf eine Infektion oder Gefäßverletzung hinweisen kann.
- Prothrombinzeit (PT/INR) Misst, wie lange es dauert, bis das Blut gerinnt, und kann bei der Beurteilung der Gerinnungsfunktion hilfreich sein.
- Fibrinogen: Ein Protein, das an der Blutgerinnung beteiligt ist; erhöhte Werte können auf eine erhöhte Gerinnungsaktivität hinweisen.
Durch klinische Untersuchungen, Bildgebung und Labortests können medizinische Fachkräfte Informationen sammeln, um Entscheidungen im Zusammenhang mit peripheren arteriellen Embolien zu treffen.
Behandlungsstrategien
Bei Verdacht auf eine periphere arterielle Embolie besteht das primäre Behandlungsziel darin, die Durchblutung der betroffenen Extremität wiederherzustellen und das Risiko weiterer Komplikationen zu verringern. Die Vorgehensweise hängt vom Schweregrad der Blockade und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten ab.
Akutbehandlung
Der erste Schritt umfasst häufig die Gabe von Antikoagulanzien. Diese werden in der Regel kurz nach der Untersuchung verabreicht. Antikoagulanzien, manchmal auch Blutverdünner genannt, verhindern die Bildung neuer Gerinnsel und können das Risiko weiterer Verstopfungen senken.
Bei schweren Symptomen oder wenn die Verstopfung den Blutfluss erheblich beeinträchtigt, können Thrombolytika in Betracht gezogen werden. Diese Medikamente sollen Gerinnsel auflösen und werden aufgrund ihres Blutungsrisikos in der Regel unter engmaschiger Überwachung im Krankenhaus verabreicht.
Chirurgische Eingriffe
In einigen Fällen können chirurgische Eingriffe erforderlich sein. Ein gängiger Ansatz ist die Embolektomie, bei der der Gerinnsel durch einen Katheter oder einen offenen chirurgischen Eingriff entfernt wird. Die Wahl der Methode hängt von der Größe und Lage der Embolie ab.
Wenn die Arterie beschädigt oder erheblich verengt ist, kann ein Bypass-Eingriff durchgeführt werden. Dabei wird mithilfe eines Transplantats ein alternativer Blutflussweg geschaffen, um die Durchblutung des betroffenen Körperteils wiederherzustellen.
Integrative und unterstützende Therapien
Nach der Behandlung der akuten Beschwerden können unterstützende Therapien die Genesung fördern. Oft wird Physiotherapie empfohlen, um die Beweglichkeit und Kraft im betroffenen Bereich wiederherzustellen. Diese Rehabilitationsprogramme können den Patienten auch dabei helfen, sich an funktionelle Veränderungen anzupassen.
Die Behandlung der zugrunde liegenden Risikofaktoren ist ein wesentlicher Bestandteil der Langzeitversorgung. Erkrankungen wie Bluthochdruck, hoher Cholesterinspiegel und Diabetes erfordern oft eine kontinuierliche Überwachung. Lebensstiländerungen wie das Aufhören mit dem Rauchen, eine herzgesunde Ernährung und körperliche Aktivität können die Gefäßgesundheit unterstützen.
Aufklärung und konsequente Unterstützung können den Betroffenen helfen, ihren Behandlungsplan einzuhalten und gesunde Gewohnheiten zu entwickeln.
Prognose und Ausblick
Die Prognose für eine PAE hängt von Faktoren wie der Schnelligkeit, mit der die Blockade behoben wird, und dem Auftreten von Komplikationen ab. Die Ergebnisse können je nach Gesundheitszustand und Schweregrad der Blockade variieren.
Nachsorgetermine helfen dabei, die Genesung zu überwachen und weitere Gesundheitsbedürfnisse zu ermitteln. Dazu können bildgebende Verfahren zur Beurteilung der Durchblutung, Bluttests zur Beurteilung der Gerinnungsfähigkeit und Kontrolluntersuchungen zur Überprüfung der Medikamenteneinnahme oder der Lebensgewohnheiten gehören.
Wichtige Erkenntnisse
- Eine periphere arterielle Embolie tritt auf, wenn eine Blockade vom Herzen den Blutfluss zu den Gliedmaßen unterbricht. Häufige Symptome sind starke Schmerzen, Kältegefühl, Blässe und fehlender Puls. Eine frühzeitige Erkennung und angemessene Behandlung können den Ausgang beeinflussen.
- Die Behandlung kann je nach Schweregrad der Blockade und dem Gesundheitszustand des Patienten eine Antikoagulationstherapie, Thrombolytika oder eine Operation umfassen.
- Die Prävention konzentriert sich auf regelmäßige Nachsorge, die Überwachung von Risikofaktoren und die Annahme gesunder Lebensgewohnheiten wie eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität, um das Risiko eines erneuten Auftretens zu verringern.
- Wenn Sie oder ein Angehöriger ein Risiko für eine periphere arterielle Embolie haben, wenden Sie sich an einen Arzt, um Rat zur Behandlung von Risikofaktoren und zur Erhaltung der allgemeinen Gesundheit zu erhalten.